Lesbarkeit: Was macht Schrift gut lesbar?
Die Gestaltung einer Schriftart spielt die entscheidende Rolle für die Lesbarkeit.
Gut gestaltete Schriftarten berücksichtigen verschiedene Faktoren, um sicherzustellen, dass der Text unabhängig vom Medium oder Kontext, in dem er dargestellt wird, klar dargestellt wird, gut zu erfassen und somit einfach zu lesen ist.
Lesbarkeit ist ein zentrales Kriterium für gute Gestaltung. Denn selbst das schönste Layout nützt wenig, wenn der Inhalt nicht klar erfasst werden kann.
Besonders im Rahmen eines professionellen Corporate Designs ist Typografie mehr als nur ein Gestaltungselement – sie trägt wesentlich zur Markenidentität bei.
Die Wahl einer gut lesbaren Schriftart ist nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern hat einen großen Einfluss darauf, wie effektiv Inhalte vermittelt und aufgenommen werden. Sie spielt eine entscheidende Rolle für die Benutzerfreundlichkeit, die Barrierefreiheit, das Verständnis und den Gesamterfolg jeder schriftlichen Kommunikation.
Schrift für Corporate Design
Neben den rein funktionalen Kriterien ist die Wahl einer passenden Schriftart ein wichtiger Erfolgsfaktor für Ihre Kommunikation. Schrift kommuniziert weit mehr als Worte allein und ist damit ein entscheidendes Instrument für die Schaffung einer dauerhaften und wirkungsvollen Markenidentität.
Schrift für Webdesign
Auch für das Webdesign spielt die Auswahl einer gut lesbaren Schrift eine wichtige Rolle. Sie verbessert die Benutzerfreundlichkeit, unterstützt die Barrierefreiheit. Eine passende und gut lesbare Schrift trägt zum Gesamterfolg einer Website bei, indem sie die Besucher anspricht und die Botschaft Ihrer Marke wirksam vermittelt.
Zwei Faktoren, die die Lesbarkeit eines Textes beeinflussen
Die Lesbarkeit eines Textes beruht auf Schriftauswahl und Typografie. Diese beiden Faktoren sind eng miteinander verbunden, stellen jedoch unterschiedliche Aspekte der Verwendung von Schriftarten in Design und Layout dar, um die Lesbarkeit zu optimieren.
Wahl der Schriftart
Die Wahl der Schriftart bezieht sich auf die Auswahl eines bestimmten Schrifttyps für einen bestimmten Text. Dazu gehören Entscheidungen über das grundlegende Design der Buchstaben, z. B. ob eine Serifenschrift oder eine serifenlose Schrift verwendet werden soll, die Buchstabenformen selbst und andere stilistische Überlegungen.
Einsatz der Schrift
Die Verwendung der Schrift umfasst die Kunst und Technik der Anordnung und Formatierung von Schrift, um geschriebene Sprache gut lesbar und visuell ansprechend zu gestalten. Dazu gehört auch die korrekte Verwendung von unterschiedlichen Schriftarten in einem Layout.
Ihr Ansprechpartner für Schrift und Typografie

Bereit für ein kostenloses Erstgespräch?
So beeinflusst die Gestaltung der Buchstaben die Lesbarkeit
Buchstabenproportionen
Die relative Weite der Buchstaben sollte nicht zu eng und nicht zu weit sein. Für eine optimale Lesbarkeit im Schnitt „regular“ sollte die Breite der Innenfläche (n) 40 % – 60 % der x-Höhe (x) betragen.
Variationen der Buchstabenbreite
Schriften wie die Futura haben große Unterschiede in der Weite der einzelnen Buchstabenformen. Dadurch wird die Lesbarkeit der schmaleren Buchstaben eingeschränkt. Schriftarten wie die Adobe Garamond haben geringere Unterschiede in der Breite der einzelnen Buchstabenformen, was die Lesbarkeit unterstützt.
Kontrast der Strichstärken
Der Kontrast einer Buchstabenform ergibt sich durch das Verhältnis von dickeren und dünneren Linien innerhalb des Buchstaben. Der Kontrast sollte nicht zu groß sein. Das Verhältnis zwischen dickster und dünnster Linienstärke sollte zwischen 3:1 und 1,5:1 liegen.
Strichstärke
Für eine gute Lesbarkeit sollte das Verhältnis der relativen Dicke des Strichs zur Höhe der Versalie weniger als 1:10 betragen. Je kleiner die Schriftgröße, desto größer sollte das Verhältnis sein.
Binnenformen
Das Verhältnis zwischen Strichstärke und Weißraum sollte ausgewogen sein. Die Kombination einer fetten Strichstärke mit wenig Binnen-Weißraum erschwert die Lesbarkeit. Eine große Binnenform in Kombination mit einer dünnen Linienstärke erschwert ebenso die Lesbarkeit.
Öffnung der Buchstabenformen
Der Weißraum (Punzen), der sich bei offenen Buchstabenformen wie z. B. „n, C, S“ oder dem unteren Teil des „e“ ergibt, sollte nicht zu klein sein, damit die Binnenform nicht geschlossen erscheint. Gerade für Leser mit Sehschwächen erschwert das die Lesbarkeit. Umgekehrt verstärken größere offene Weißräume die Individualität der Buchstabenform und verbessern so die Lesbarkeit.
Mittellänge
Der Unterschied der Höhe von Versalien und Minuskeln wirkt sich stark auf die Lesbarkeit aus. Schriften mit großen x-Höhen wirken normalerweise größer als Schriften mit kleineren x-Höhen. Gerade bei kleineren Schriftgrößen hat dieses Verhältnis große Auswirkungen auf die Lesbarkeit.
Die x-Höhe (Höhe des Kleinbuchstabens x) sollte zwischen 67 % und 75 % der Versalhöhe betragen. Einige Leser mit Dyslexie finden dagegen Schriftarten mit größeren Ober- und Unterlängen besser lesbar.
Auch Oberlängen der Minuskeln, welche die Versalhöhe überschreiten, erhöhen die Erkennbarkeit der einzelnen Buchstabenformen und somit die Lesbarkeit der Schrift.
Ähnliche Buchstabenformen
Schriften, die sehr ähnliche Buchstabenformen für verschiedene Buchstaben aufweisen sind schlechter lesbar. So können „l, L,1, i“ leicht verwechselt werden, wenn sie keine individuelle Ausformung haben, z. B. durch Verwendung von Serifen.
Spiegelungen
Schriften, die gespiegelte Buchstabenformen „db“ oder „pq“ verwenden sind schlechter lesbar, besonders für Leser mit Dyslexie.
Schlecht unterscheidbare Buchstabenformen
Schriftarten mit sehr ähnlichen Buchstabenformen z. B. sehr geometrisch konstruierte Schriften wie ITC Avant Garde Gothic „a, o, g“ erschweren die Lesbarkeit. Die Grundform erscheint hier auf den ersten Blick bei allen drei Buchstaben als Kreis. Individuellere Buchstabenformen wie z. B. die der Fiera sind dagegen besser unterscheidbar und somit besser lesbar.
Ebenso erhöht ein ausgeprägter „Schweif“ an den Abstrichen die klare Erkennbarkeit.
Gute Lesbarkeit durch richtigen Umgang mit Schrift
Schriften sollten gezielt eingesetzt werden. So können, mit gut lesbaren Schriften, die Nutzer/Leser Inhalte besser und schneller erfassen. Darüber hinaus unterstützt eine gute Typografie die Barrierefreiheit bzw. -armut.
Folgende Kriterien spielen dabei eine Rolle:
- Schriftgröße
- Laufweite
- Zeilenabstand
- Zeilenlänge
- Ausrichtung
- Formatierung



Schriftgröße
Jede Schrift ist einzigartig. Unterschiedliche Schriftarten in der genau gleichen Punktgröße sind unterschiedlich groß. Auch die Größe der Versalien kann sich erheblich unterscheiden. Auch Leseabstand, Umgebungslicht und ob gedruckt oder auf dem Bildschirm gelesen wird, hat einen großen Einfluss.
Für Texte, die auf einem Bildschirm gelesen werden, sollte der Nutzer die Schriftgröße selber einstellen können. Bei gedruckten Texten kann die Schriftgröße nicht angepasst werden. Die Schriftgröße sollte für Ältere und Menschen mit Sehschwäche entsprechend gewählt werden.
Laufweite
Auch wenn eine geringere Laufweite vielen ästhetischer erscheint, erschwert dies die Lesbarkeit, da die individuellen Buchstabenformen dann schlechter zu unterscheiden sind.
Eine etwas größere Laufweite kann einen großen Unterschied machen, sollte aber sehr vorsichtig eingesetzt werden.
Die Laufweite sollte erhöht werden:
- wenn die Schriftart eine vergleichsweise geringe Laufweite aufweist,
- wenn die Schrift in Versalien/Kapitalen gesetzt wird,
- wenn die Schrift „bold“ oder „heavy“ eingesetzt wird,
- wenn heller Text auf dunklem Hintergrund steht.
Durchschuss
Die meisten Programme setzen den Durchschuss standardmäßig auf 120 % der Schriftgröße (z. B. eine Schrift in 10 Punkt hat dann einen Durchschuss von 12 Punkt.). Das ist im Sinne der Barrierefreiheit zu wenig.
Für sehbeeinträchtigte Personen sollte der Durchschuss zwischen 125 % und 150 % der Schriftgröße liegen. Dies ist immer abhängig von der Gestaltung der Schrift und den Proportionen zu beurteilen.
Abstände
Die Abstände zwischen Absätzen oder Spalten sollten ebenso etwas größer gewählt werden.
Einzüge
Diese sollten vermieden werden. Der Spaltenabstand sollte merklich größer sein als der Abstand zwischen den Absätzen. Wenn möglich sollten mehrere Spalten vermieden werden.
Zeilenlänge
Kurze Zeilenlängen erfordern ein häufiges Springen zum Anfang der nächsten Zeile. Längere Zeilenlängen erschweren es den Anfang der nächsten Zeile zu finden. Auch für Menschen mit Bewegungseinschränkungen im Nacken/Hals sind längere Zeilen unkomfortabel. Die Zeilenlänge sollte zwischen 45 und 90 Zeichen inklusive Leerzeichen liegen.
Ausrichtung
Linksbündiger Satz ist die beste Wahl für Schriften, die von links nach rechts gelesen werden. Der gerade linke Rand ergibt beim Zeilensprung eine gleichbleibende Startposition für das Auge.
Blocksatz
Blocksatz vermeidet die Ablenkung durch unterschiedliche Zeilenlängen und den ausgefransten Rand auf der rechten Seite des Absatzes.
Oft kann Blocksatz allerdings nur erreicht werden, indem Zeichen- und Wortabstände entsprechend vergrößert oder verkleinert werden. So können unschöne „Löcher“ zwischen Worten und vertikale Weißräume über mehrere Zeilen entstehen, die das Lesen sehr erschweren. Blocksatz sollte nur dann eingesetzt werden, wenn die technischen Voraussetzungen und das nötige Wissen vorhanden ist und diese Probleme vermieden werden.
Kapitale
Satz in Versalien/Kapitälchen sollte nur sehr selten zum Einsatz kommen, da der Text so schwerer zu lesen ist.
Formate
Schriftformate wie „bold“, „italic“ oder „underline“ sollten ebenfalls nur sehr restriktiv eingesetzt werden.
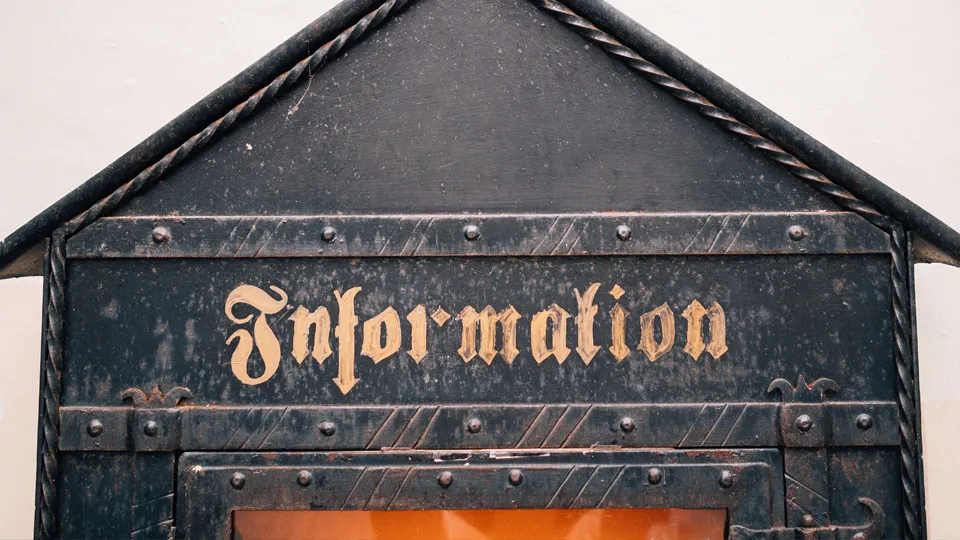

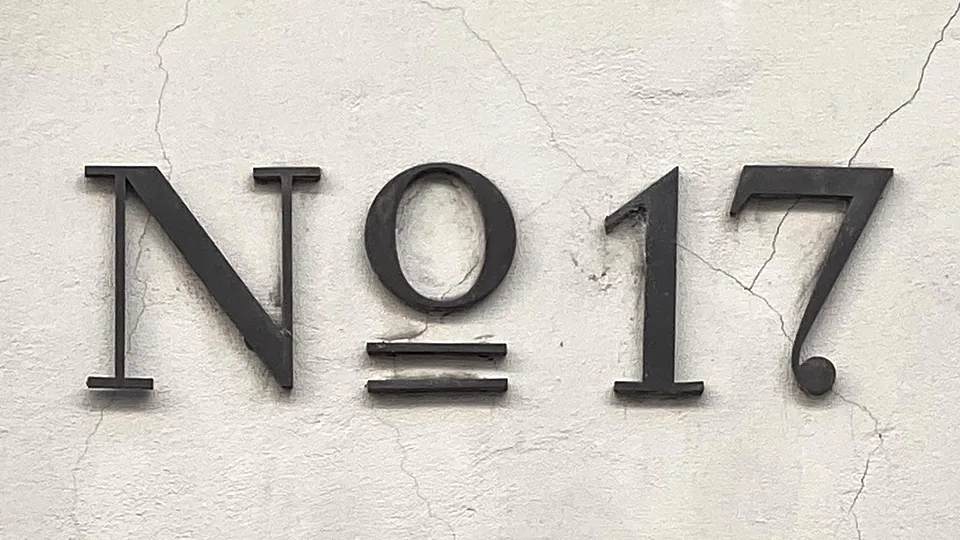
Kriterien zur Auswahl einer passenden Schrift
- Gute Lesbarkeit on- und offline.
- Passend zur Marke.
- Eigenständig in der Erscheinung.
- Gut genug ausgebaut für alle Einsatzzwecke.
- Im Budget für alle Anwendungen.
Die Macht der Gewohnheit
Menschen gewöhnen sich an Schriften und finden diese dann am besten lesbar. Das heißt allerdings nicht, dass die meist verwendeten Schriften wie Helvetica, Arial, Times, Verdana auch die am besten lesbaren Schriften sind. Die Gewohnheit der Auftraggeber ist ein Punkt, den man beachten muss, um eine wirklich gut lesbare Schrift für ein Projekt zu finden.
Gute Lesbarkeit und Barrierefreiheit
Für die barrierefreie oder barrierearme Schriften gelten grundsätzlich dieselben Anforderungen, die an eine gut lesbare Schrift gestellt werden. Gute Lesbarkeit sorgt also automatisch für Barrierearmut.

Bereit für Design mit Wirkung?
Persönlich, zielgerichtet, effizient – seit über 20 Jahren entwickeln wir Designlösungen, die nicht nur gut aussehen, sondern Ergebnisse liefern.
Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen – kostenlos und unverbindlich.
→ Zum Kontaktformular